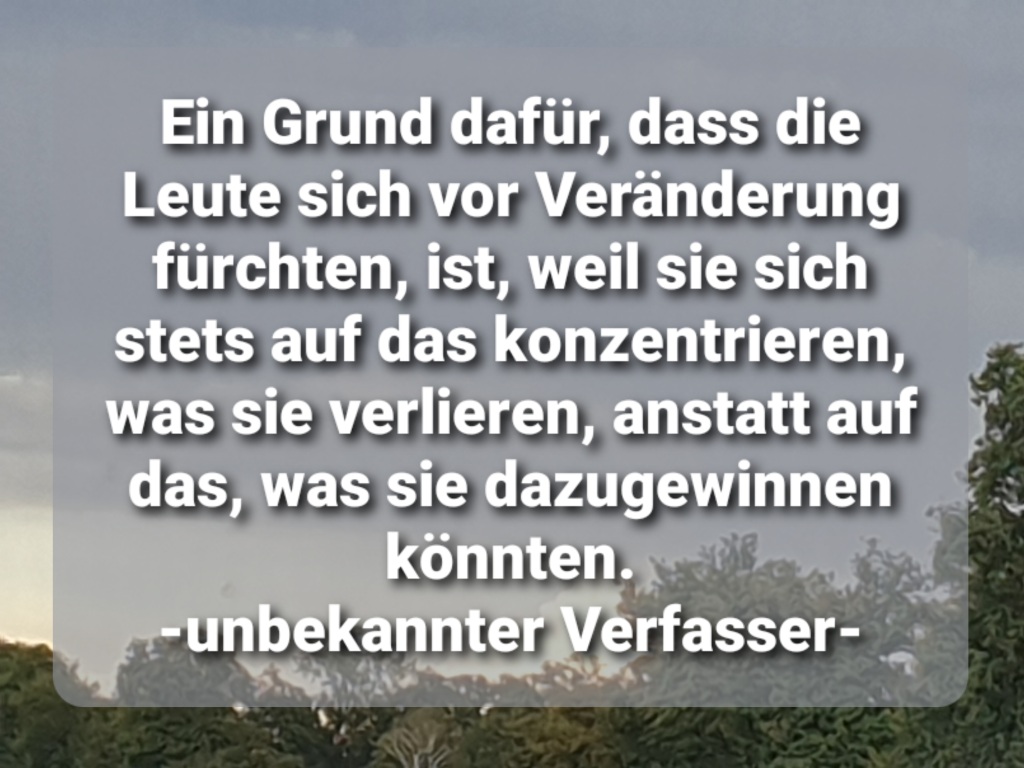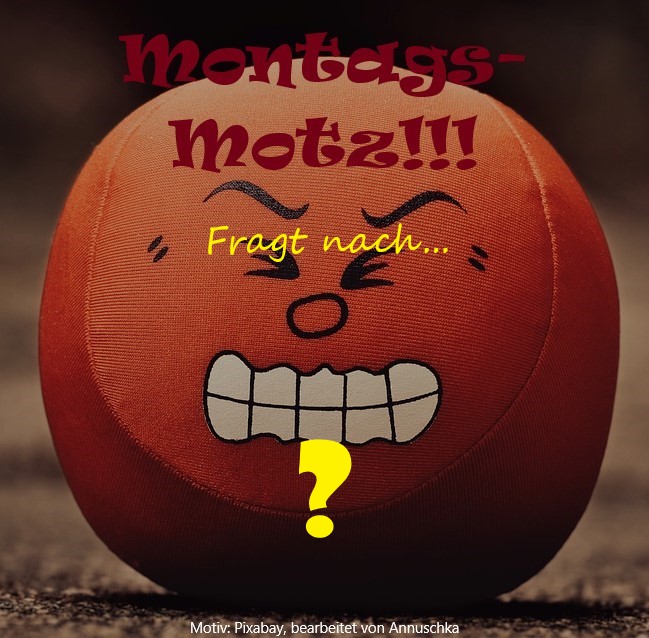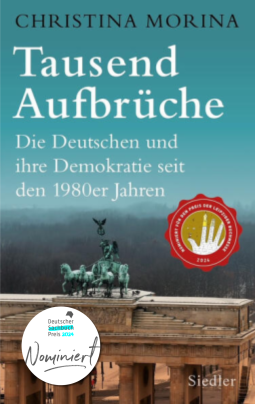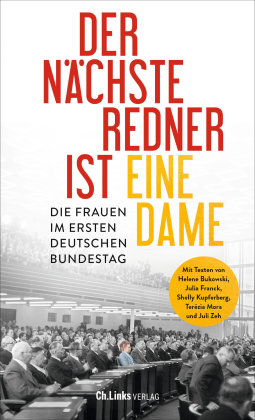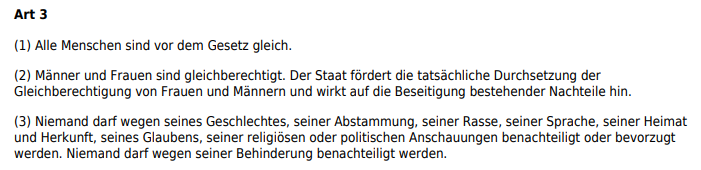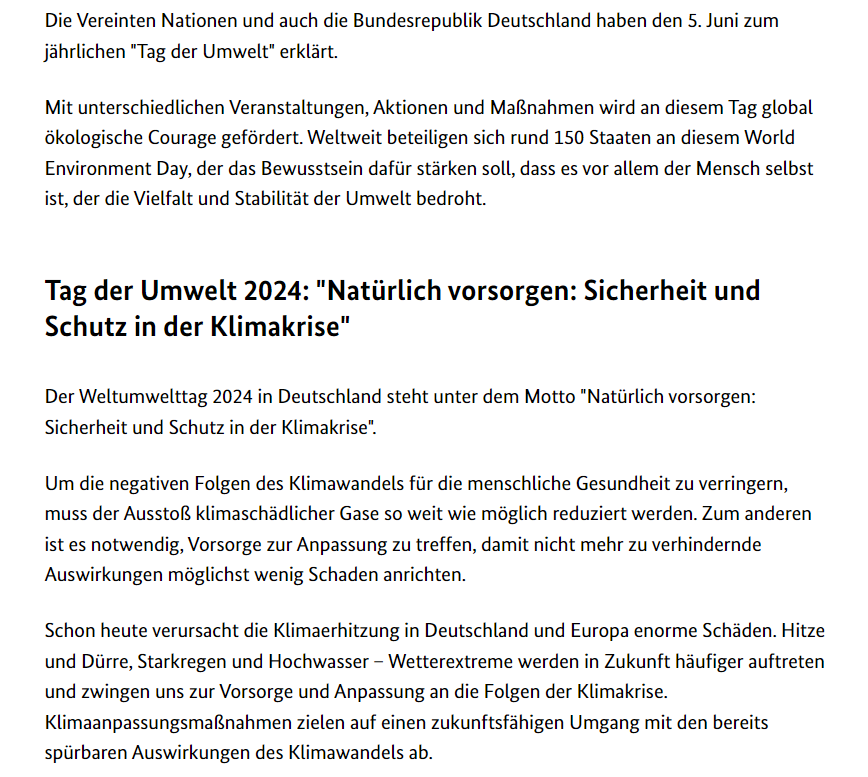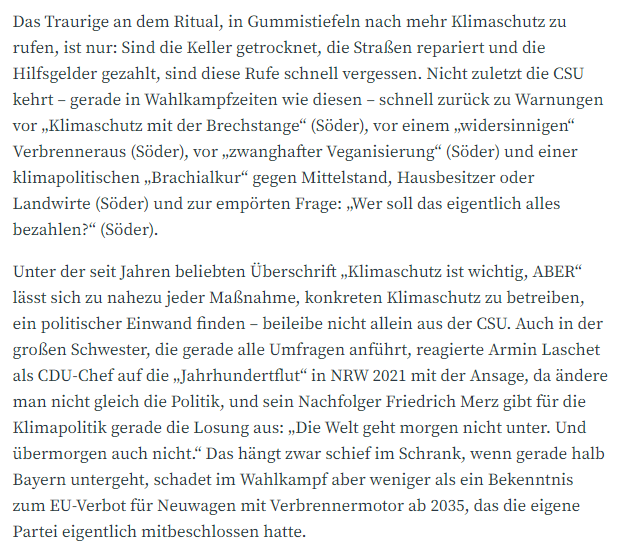Von Abschieden, Wehmut und düsteren Träumen
Freitagabend. Wieder erleben wir, wie öfter in der letzten Zeit, ein „letztes Mal“.
Für unsere jüngste Tochter, aber auch für uns. Bei jedem von uns (Papa, Mama, große Schwester – im Vorfeld sogar bei der anderen großen Schwester, die nicht dabei sein kann) macht sich ein wenig Wehmut breit.
Das letzte Sommerkonzert. Das letzte Mal im vollbesetzten Forum applaudieren, freuen, schrägen Ansagen der Musiklehrer lauschen, mitsingen, Zugabe einfordern…
Aber zum Glück hat sich noch etwas anderes eingeschlichen:
Ein „erstes Mal“ war vom Publikum nicht nur Singen gefordert, sondern auch Körpereinsatz, als die Brassband den Time Warp aus der Rocky Horror Picture Show spielte, von einem Schüler der Q1 dirigiert.
Und er dirigierte virtuos nicht nur die Band, sondern das Publikum gleich mit. Kunststück, kannten doch vermutlich mehr Eltern und Großeltern sowohl Film, Song als auch Tanz als es bei den Schülerinnen und Schülern der Fall war.
Oscar, auch wenn du das hier wohl eher nicht lesen wirst: DANKE!
Die andere „Neuigkeit“ wurde von unserer Ältesten mit dem Satz: „Symbolbild für das deutsche Schulsystem“ (wobei sie eher die bauliche Situation meinte) ironisch kommentiert. Im ersten Drittel des Konzerts ging über Porta Westfalica ein Starkregen herab (später sah ich zuhause am Regenmesser: 22 Liter/qm waren innerhalb kürzester Zeit runtergepladdert), der sich seinen Weg auch durch das undichte Dach bis ins Forum bahnte und Menschen zum hektischen Platzwechsel veranlasste, während Schülerinnen und ein Lehrer sämtliche Putzeimer und Feudel aktivierten…
In der Konzertpause stellte sich dann noch heraus, dass der Bandkeller ebenfalls geflutet wurde, vermutlich durch ein undichtes Fenster.
Ärgerlich, aber die Schulleitung hat nun jede Menge Zeugen, die gern bestätigen werden, dass die Stadt investieren muss!
Ob irgendjemand von den Programmverantwortlichen eine Vorahnung hatte? Die Songs, die auf die unfreiwillige Dusche folgten, waren unter anderem:
Sunroof, Bring me little water Silvy und Skyfall.
Egal. Wichtig ist und bleibt die tolle Stimmung während des Konzerts und die erneute Feststellung, dass zwischen allen Beteiligten: den unterschiedlichen Chören, dem Orchester, der Brass Band, den kleinen Gruppen Vokalpraxis und Violino Virtuoso sowie den MusiklehrerInnen ein vertrautes und partnerschaftliches Miteinander im Umgang herrscht sowie der unbedingte Wille, dem Publikum und sich selbst ein rundum schönes Konzerterlebnis zu bieten. So sollte Schule viel häufiger erlebbar sein.
Ich dachte im Lauf des Abends mit ein wenig Wehmut daran, wie viele Sommer- und Weihnachtskonzerte wir hier erlebt haben, leider durch die Corona-Zeit unterbrochen, in der manches abgerissen ist, unter anderem die musikalische Ausbildung der jüngeren Schüler. Wie aufgeregt wir waren, als unser Küken zum ersten Mal mit dem Unterstufenchor auf der Bühne stand, wie groß die Freude war, als das erste Konzert nach der Pandemie wieder stattfinden konnte.
Ich ließ die Jahre Revue passieren: wie sehr sich unser Mädel von der schüchternen Fünftklässlerin entwickelt hat, die mit persönlichen, sehr großen und kräftezehrenden Herausforderungen zu kämpfen hatte, wie sie zu einer reflektierten, für sich selbst (und alle , die ihr wichtig sind) einstehenden jungen Frau herangereift ist.
Und auch, wie sehr wir als Eltern dankbar für alle unsere Töchter sind, die so unterschiedliche Begabungen haben, aber sich alle drei ihren Platz im Leben erarbeitet haben und es weiterhin tun.
Dummerweise habe ich gerade in diesem Sommer, in dem unsere Tochter relativ unbeschwert ihre Jugend genießen kann, mal nicht so auf Zeiten achten muss und sich Freiheiten herausnehmen darf, ein abgeschlossen geglaubtes Problem mit diffusen, unheilvollen Träumen.
Nach langen Jahren Ruhe davon. Denn es gab eine Zeit, da wollte ich nicht mehr träumen.
Das erste Mal träumte ich, ich käme von der Kursfahrt nach Wien zurück und mein Vater wäre nicht mehr da. Ich kam nach Hause und mein Vater war gestorben, während ich Wien unsicher machte.
Das zweite Mal träumte ich vor einem Frankreich-Urlaub, dass wir einen Unfall hätten und so kam es dann auch.
Das dritte Mal schließlich verabschiedete sich in der Nacht meine Mutter von mir und am nächsten Tag bekam ich den Anruf aus dem Krankenhaus…
In den letzten Wochen hatte ich immer mal wieder sehr diffuse Träume, in denen ich ein nicht definierbares Unglück spürte. Alles wie in Watte gehüllt und doch präsent. Ich glaube nicht wirklich, dass ich für Spökenkiekerei empfänglich bin. Verstandesgemäß ist es nicht einmal weit hergeholt in diesen unruhigen Zeiten, die mir anscheinend mehr zu schaffen machen als ich mir eingestehen mag, dass ich Mist träume und dabei Ängste verarbeite.
Allerdings: wenn alle anderen zuhause sind, soweit ich es überblicken kann, projiziere ich vermutlich alles Unbehagen, das mich erfasst, wenn ich aus solchen Träumen aufwache, auf die einzige Person, die fröhlich feiernd die Nacht zum Tag macht. Leider führt das dazu, dass ich mich wie eine gluckende Henne verhalte. Ich ärgere mich über meine Schreckhaftigkeit und schimpfe mit mir wie ein Rohrspatz, aber kann auch irgendwie nicht aus meiner Haut.
Wird Zeit, dass Urlaub ist. Und mehr Zuversicht in der Gesellschaft wäre auch toll.